Projekte nachkalkulieren: Tipps & Best Practices
von Alexander Huber
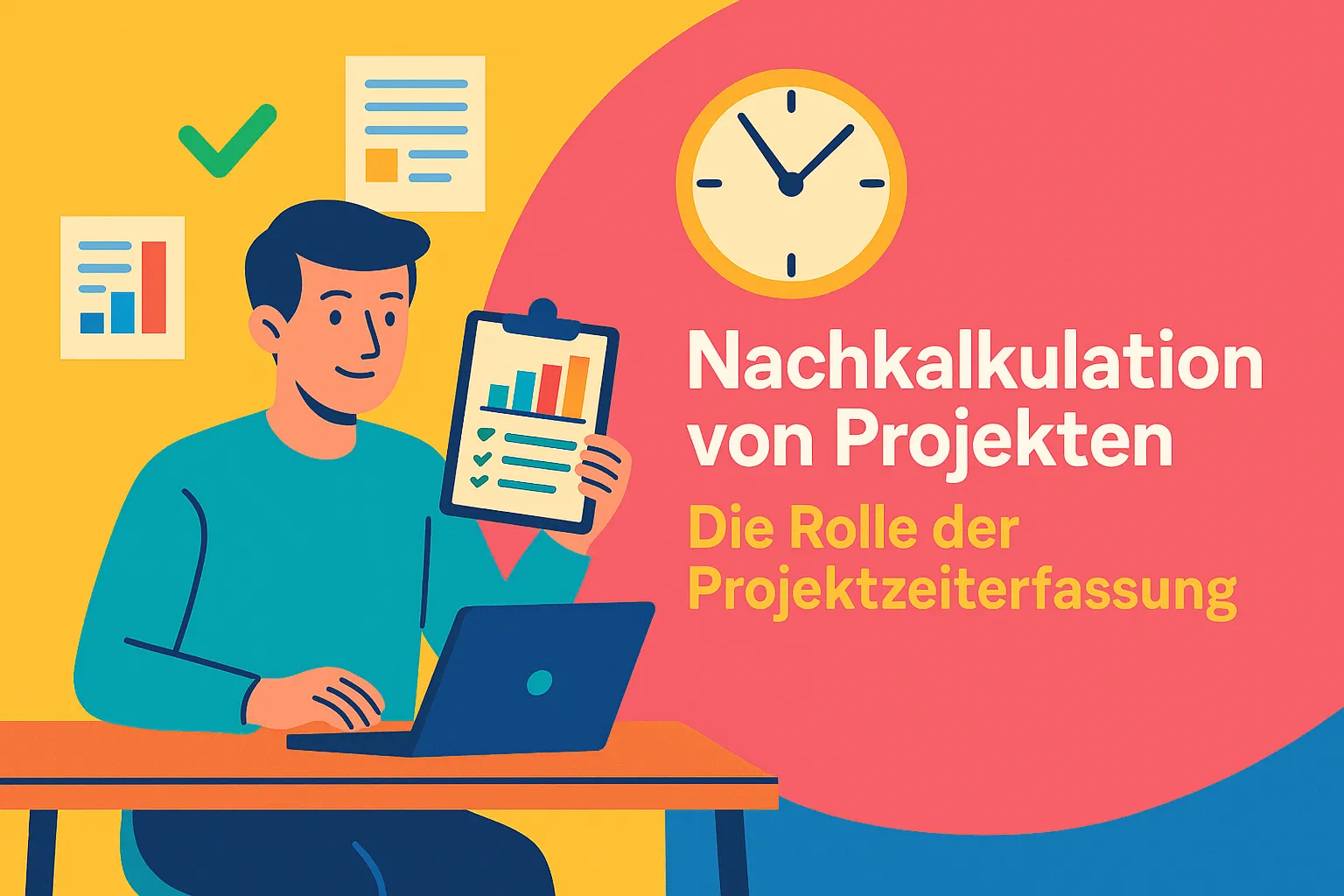
Laut dem CHAOS Report 2020 der Standish Group verlaufen nur rund 31 % der IT-/Softwareprojekte wirklich erfolgreich. 50 % gelten als herausfordernd (Abweichungen bei Budget, Zeit oder Umfang), und 19 % scheitern komplett. (CDT)
Projekte starten mit ambitionierten Plänen – am Ende jedoch sind sie oft teurer, länger oder weniger profitabel als gedacht. Die große Frage lautet dann: „Woran lag es?“
Genau hier setzt die Nachkalkulation Projekt an. Sie ist der strukturierte Blick zurück, um Soll- und Ist-Werte zu vergleichen, Abweichungen zu verstehen und daraus Lernkurven für die Zukunft abzuleiten. Doch ohne solide Projektzeiterfassung bleibt sie ein Blindflug.
Was ist eine Projekt Nachkalkulation?
Eine Nachkalkulation ist ein betriebswirtschaftliches Verfahren, mit dem Unternehmen die tatsächlichen Projektkosten und den erzielten Ertrag nach Projektabschluss erfassen und mit den geplanten Werten vergleichen.
Kernziele einer Nachkalkulation
- Transparenz: Aufzeigen, ob das Projekt profitabel war.
- Abweichungsanalyse: Welche Phasen oder Aufgaben haben mehr Ressourcen benötigt als geplant?
- Lerninstrument: Verbesserung künftiger Kalkulationen, Schätzmethoden und Angebotsqualität.
- Steuerungsimpuls: Daten für Preisgestaltung, Margenkalkulation und Prozessoptimierung.
Im Projektkontext bedeutet Nachkalkulation also weit mehr als eine buchhalterische Pflicht. Sie wird zum Controlling-Werkzeug, das operativ und strategisch Nutzen stiftet.
Warum Projektzeiterfassung die Grundlage ist
Eine Nachkalkulation kann nur so gut sein wie die Daten, auf denen sie basiert. Für Dienstleister gilt: Zeit = Geld.
Ohne Zeitdaten keine Transparenz
Wenn nicht erfasst wird, wie viele Stunden Entwickler, Berater oder Projektleiter in welches Arbeitspaket investiert haben, bleiben die größten Kostentreiber unsichtbar.
Zeiterfassung bringt:
- Objektivität: Fakten statt Bauchgefühl.
- Granularität: Aufwände lassen sich einzelnen Projekten, Kunden oder Aufgaben zuordnen.
- Vollständigkeit: Auch nicht-fakturierbare Stunden werden sichtbar.
- Compliance: In vielen Ländern (EU, AT, DE) ist eine Arbeitszeiterfassung ohnehin Pflicht.
Ein Praxisbeispiel aus unserer Erfahrung: Ein IT-Unternehmen hatte Projekte immer „im Kopf“ nachkalkuliert – bis wir Projektzeiterfassung eingeführt haben. Erst dann wurde sichtbar, dass rund 15 % der Stunden zwar geleistet, aber nie fakturiert wurden. Das führte zu systematischem Margenverlust – ein klassischer Fall von Revenue Leakage.
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachkalkulation
Damit eine Nachkalkulation nicht nur Zahlen liefert, sondern auch Erkenntnisse, braucht es bestimmte Rahmenbedingungen.
1. Saubere und detaillierte Projektstruktur
- Projekte sollten in Arbeitspakete zerlegt sein.
- Diese dienen als „Behälter“ für Zeiten, Kosten und externe Leistungen.
- Nur so lassen sich Abweichungen präzise lokalisieren.
☝️ Aber Achtung: Verzetteln Sie sich nicht in übermäßiger Detailtiefe. Die Kunst liegt darin, eine Projektstruktur zu schaffen, die präzise genug für eine saubere Nachkalkulation, aber nicht zu kleinteilig ist. Müssen Mitarbeitende erst lange nach dem passenden Arbeitspaket suchen, empfinden sie die Zeiterfassung schnell als mühsam. Eine elegante Lösung: Mitarbeitende nur mit den Arbeitspaketen zu konfrontieren, die für sie relevant sind. So sehen sie ausschließlich die Aufgaben, für die sie tatsächlich eingeplant sind – und die Buchung wird erheblich einfacher und schneller.
2. Konsequente Projektzeiterfassung
- Tägliche Buchung („Same-Day-Booking“) verhindert Gedächtnisfehler.
- Tools sollten den Aufwand für die Zeiterfassung minimieren.
- Auch nicht abrechenbare Zeiten müssen erfasst werden (Meetings, Bugfixing, interne Abstimmungen).
🤔 Seien wir ehrlich: Viele Mitarbeitende erfassen ihre Zeiten nicht sofort, weil sie tief in der Arbeit stecken oder von Meeting zu Meeting hetzen. Genau hier können digitale Assistenten unterstützen – etwa der Activity Tracker von time cockpit. Er zeichnet automatisch auf, an welchen Dateien, Programmen oder Projekten gearbeitet wurde. So haben Mitarbeitende später eine zuverlässige Gedächtnisstütze und können ihre Zeiten mit wenigen Klicks korrekt nachtragen.
3. Vollständige Kostenerfassung
- Neben Eigenleistungen auch Fremdleistungen, Material- und Reisekosten berücksichtigen.
- Transparenz über Preisabweichungen vs. Mengenabweichungen schaffen. In der Nachkalkulation ist es entscheidend, Abweichungen nicht nur festzustellen, sondern auch ihre Ursachen zu verstehen. Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen Mengenabweichungen und Preisabweichungen. Eine Mengenabweichung entsteht, wenn für bestimmte Arbeitspakete mehr Stunden oder Leistungen benötigt wurden als ursprünglich geplant. Eine Preisabweichung hingegen liegt vor, wenn die Kosten pro Einheit – etwa Stundensätze externer Dienstleister oder Lizenzpreise – höher ausfallen als kalkuliert. Nur wenn diese beiden Dimensionen transparent getrennt betrachtet werden, lassen sich die richtigen Schlüsse ziehen und zukünftige Kalkulationen gezielt verbessern.
💡 Während ein Zeiterfassungssystem vor allem die Eigenleistungen (Arbeitsstunden) zuverlässig abbildet, braucht es für eine vollständige Nachkalkulation oft zusätzliche Datenquellen. Fremdleistungen, Material- oder Reisekosten werden meist in ERP-Systemen, Buchhaltungslösungen oder spezialisierten Reporting-Tools erfasst. Erst die Kombination dieser Informationen liefert ein vollständiges Kostenbild.
4. Definierte Baseline und Kennzahlen
Eine Nachkalkulation ist nur so gut wie die Vergleichsdaten, die zu Projektbeginn festgelegt wurden. Dazu gehört, dass Planwerte klar dokumentiert sind – etwa geplante Stundenbudgets pro Phase, kalkulierte Kostenarten (Eigenleistungen, Fremdleistungen, Reisekosten) und geplante Meilensteine. Diese Daten bilden die Baseline, an der später alle Ist-Werte gemessen werden.
5. Regelmäßige Auswertung statt einmaligem Abschluss
- Erfolgreiche Unternehmen prüfen laufend: Wöchentlich oder monatlich Plan-Ist-Vergleiche ziehen.
- So wird Nachkalkulation von einer reinen Ex-Post-Analyse zu einem Frühwarnsystem.
🎯 Damit Plan-Ist-Vergleiche wirklich aussagekräftig sind, ist es entscheidend, dass die Zeiterfassung zeitnah erfolgt. Werden Stunden erst Wochen später nachgetragen, gehen wichtige Details verloren, und Abweichungen bleiben unentdeckt. Ohne aktuelle Daten gleicht die Projektsteuerung einem Blindflug. Erfolgreiche Unternehmen prüfen daher wöchentlich oder monatlich ihre Werte und nutzen die Nachkalkulation nicht nur am Ende, sondern als laufendes Frühwarnsystem.
6. Lessons Learned als Kultur verankern
Eine Nachkalkulation ist nur dann wertvoll, wenn die Ergebnisse nicht im Archiv verschwinden, sondern aktiv genutzt werden. Abweichungen sollten dabei nicht als Schuldzuweisung verstanden werden, sondern als Lernchance. Wichtig ist eine offene Gesprächskultur, in der Ursachen wie Schätzfehler, unklare Anforderungen oder externe Einflüsse ehrlich benannt werden können.
Ein Projektabschlussbericht dokumentiert diese Erkenntnisse und leitet konkrete Empfehlungen für die Zukunft ab – etwa Pufferregeln, verbesserte Schätzmethoden oder klarere Change-Request-Prozesse. So wird Nachkalkulation zu einem kontinuierlichen Verbesserungsinstrument, das Projekte planbarer und profitabler macht.
Schritt-für-Schritt: So läuft eine Nachkalkulation ab
Schritt 1: Projektzeiterfassung einführen
Alle Teammitglieder sollten ihre Zeiten regelmäßig, am besten täglich, erfassen. Moderne Tools reduzieren den Aufwand erheblich und sorgen dafür, dass die Daten vollständig und konsistent sind.
✅ Genau hier können digitale Assistenten unterstützen – etwa der Activity Tracker von time cockpit.
Schritt 2: Projektstruktur anlegen
Eine saubere Struktur mit klar definierten Phasen und Arbeitspaketen ist die Grundlage jeder Nachkalkulation. Nur wenn Aufgaben und Verantwortlichkeiten eindeutig zugeordnet sind, können später Abweichungen präzise festgestellt werden.
👉 Beispiel: In einem ERP-Einführungsprojekt werden die Phasen „Anforderungsanalyse“, „Implementierung“, „Test“ und „Go-Live“ definiert – so sieht man später sofort, wo die meisten Zusatzstunden angefallen sind.
Schritt 3: Kosten erfassen
Neben internen Stundensätzen gehören auch Fremdleistungen, Reisekosten oder Lizenzgebühren in die Nachkalkulation. Erst wenn alle Kostenarten erfasst sind, entsteht ein vollständiges Bild der Projektrealität.
👉 Beispiel: Beim Cloud-Projekt für einen Kunden werden nicht nur Entwicklerstunden berücksichtigt, sondern auch externe Microsoft Azure-Kostennachweise und Reisekosten für Workshops.
Schritt 4: Plan-Ist-Vergleich
Im nächsten Schritt werden die geplanten Aufwände den tatsächlich erfassten Zeiten und Kosten gegenübergestellt. Abweichungen lassen sich so frühzeitig erkennen und systematisch dokumentieren.
👉 Beispiel: Geplant waren 120 Stunden für die Testphase, tatsächlich verbrauchte das QA-Team 180 Stunden – hier zeigt die Nachkalkulation sofort eine Überlastung im Testing.
Schritt 5: Ursachenanalyse
Wichtiger als die bloße Feststellung der Abweichung ist die Frage nach dem „Warum“. Typische Gründe sind Schätzfehler, unklare Anforderungen (Scope Creep) oder ineffiziente Abläufe im Projekt.
👉 Beispiel: In einem Webshop-Projekt zeigt sich, dass viele Zusatzstunden durch kurzfristige Änderungswünsche des Kunden entstanden sind – die Ursache lag im fehlenden Change-Request-Prozess.
Schritt 6: Lessons Learned
Die Ergebnisse der Nachkalkulation sollten nicht in der Schublade verschwinden, sondern aktiv genutzt werden. Indem Erkenntnisse in künftige Angebotskalkulationen und Projektmethoden einfließen, verbessert sich die Planung Schritt für Schritt.
👉 Beispiel: Nach einem Data-Warehouse-Projekt wird entschieden, bei künftigen Angeboten immer 20 % Puffer für Datenmigration einzuplanen – weil genau hier in der Vergangenheit wiederholt Abweichungen entstanden.
Typische Fehlerquellen in der Nachkalkulation
Unvollständige Zeitdaten: Eine der größten Stolperfallen sind unvollständige Zeitdaten. Wenn Mitarbeitende ihre Stunden nur sporadisch oder im Nachhinein erfassen, entsteht kein verlässliches Bild der tatsächlichen Aufwände. Die Nachkalkulation basiert dann auf Schätzungen und verliert ihren Wert.
Zu grobe Projektstruktur: Eine der größten Stolperfallen sind unvollständige Zeitdaten. Wenn Mitarbeitende ihre Stunden nur sporadisch oder im Nachhinein erfassen, entsteht kein verlässliches Bild der tatsächlichen Aufwände. Die Nachkalkulation basiert dann auf Schätzungen und verliert ihren Wert.
Kein Blick auf nicht-fakturierbare Zeiten: Ein weiterer Klassiker: nicht-fakturierbare Zeiten werden ignoriert. Gerade interne Abstimmungen, Meetings oder Bugfixing summieren sich und beeinflussen die Rentabilität erheblich. Wenn diese Zeiten nicht erfasst und bewertet werden, wirkt das Ergebnis künstlich positiv.
Nachkalkulation zu spät: Und schließlich wird die Nachkalkulation häufig erst am Projektende gemacht. Damit bleibt sie ein reiner Rückblick ohne Steuerungswirkung. Erfolgreiche Unternehmen hingegen setzen auf regelmäßige Auswertungen während des Projekts und nutzen sie als Frühwarnsystem.
Warum Nachkalkulation besonders für IT-Dienstleister wichtig ist
Hoher Anteil an Personalkosten: Gerade im IT-Umfeld ist die Nachkalkulation ein zentrales Instrument. Der Grund: Der größte Kostenblock sind Personalkosten. Jede Stunde, die nicht erfasst oder falsch zugeordnet wird, verzerrt sofort das wirtschaftliche Ergebnis.
Hoher Wettbewerbsdruck: Hinzu kommt der starke Wettbewerbsdruck. Margen in IT-Dienstleistungsprojekten sind oft knapp bemessen. Transparenz über Zeit- und Kostenabweichungen entscheidet deshalb direkt über Gewinn oder Verlust.
Hohe Änderungsdynamik: Auch die dynamische Projektlandschaft macht Nachkalkulation unverzichtbar. Agile Methoden, Scope-Änderungen oder wechselnde Anforderungen führen dazu, dass Projekte selten exakt nach Plan laufen. Wer hier nicht laufend nachkalkuliert, verliert schnell den Überblick.
Rechtliche Rahmenbedingungen: Schließlich spielen auch rechtliche Rahmenbedingungen eine Rolle. In vielen Ländern ist die lückenlose Zeiterfassung mittlerweile Pflicht. Damit wird sie nicht nur zur Grundlage für die Nachkalkulation, sondern auch zum Bestandteil von Compliance und Unternehmenssicherheit.
Fazit
Eine Nachkalkulation von Projekten ist weit mehr als eine “Pflichtübung”. Sie entscheidet über Rentabilität, Planungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Die wichtigste Voraussetzung: eine strukturierte Projektzeiterfassung, die alle relevanten Aufwände sichtbar macht.
👉 Gerade für IT-Dienstleister gilt: Wer Projekte nur einmal plant, aber nie nachkalkuliert, riskiert wiederkehrende Fehler. Wer dagegen konsequent Zeiten erfasst, laufend vergleicht und Learnings zieht, baut ein nachhaltiges Fundament für bessere Margen und zufriedene Kunden. Damit wird Nachkalkulation vom reinen Rückspiegel zum echten Steuerungsinstrument.